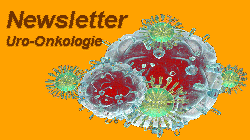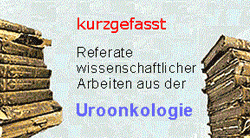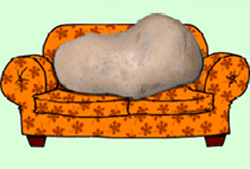Neurogene Blase: Neue Videoserie unterstützt
Therapieerfolg
Die neue siebenteilige Videoserie unterstützt Ärzt:innen bei der Aufklärung von Patient:innen mit neurogener Blasenfunktionsstörung. Ziel ist es, den Ärzt:innen die Kommunikation zu erleichtern und so die Therapietreue und das Verständnis der Patient:innen nachhaltig zu verbessern.
Die intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) ist eine etablierte Methode zur Entleerung der Harnblase bei Detrusorhyperaktivität infolge einer neurologischen Funktionsstörung [1, 2]. Sie wird in der Regel therapeutisch mit der medikamentösen Gabe eines Anticholinergikums kombiniert, das die parasympathisch vermittelten Kontraktionen des Detrusors reduziert.
Adhärenz bleibt zentrale Herausforderung
Die ISK bietet viele Vorteile, allen voran die wirksame Vermeidung von Harnwegsinfektionen, Erhalt der Nierenfunktion sowie Verbesserung der Lebensqualität durch mehr Selbständigkeit [2]. Dennoch zeigen die Daten, dass die Adhärenz im Langzeitverlauf häufig abnimmt [2] und die Non-Adärenzraten allgemein zwischen 18% und 66% liegen [3]. Laut den Ergebnissen einer prospektiven Studie befolgten nur 15% der Teilnehmenden mit einer Querschnittslähmung und neurogenen Blase vollständig den Katheterplan, 59% waren teilweise adhärent und 26 % brachen die ISK-Anwendung ab [4]. In einer Langzeitstudie lag die Rate der ISK-Anwendung bei einem ähnlichen Patient:innenkollektiv bei Entlassung aus der Rehabilitation bei 63,4 % und war bei der telefonischen Follow up-Befragung nach im Mittel 54 Monaten auf 37,5% gesunken [5].
Unzureichende Anleitung mit ein Hauptgrund für Non-Adhärenz
Die Gründe für die Non-Adhärenz sind vielfältig und beruhen auf internen, patient:innen-bezogenen Barrieren wie eine eingeschränkte Handfunktion, der für die Katheterisierung erforderliche Zeitaufwand sowie eine begrenzte Unterstützung durch Pflegepersonen und/oder auf externen Barrieren [2, 6]. Dazu gehören neben dem Fehlen barrierefreier Toiletten im öffentlichen Raum vor allem ein unzureichendes Training. Wie wichtig dies ist, zeigen auch die Daten einer Studie, bei der ein Video-unterstütztes ISK-Training signifikant die praktischen Fertigkeiten („ISK Skill“-Checkliste) sowie das Selbstvertrauen der Patient: innen im Vergleich zur Standard-Schulung (p <0,001) verbesserte [7]. Zusätzlich entwickelten trainierte Patient:innen weniger Komplikationen wie Harnwegsinfektionen, Inkontinenz, Hämaturie oder Harnröhrenstrikturen (p <0,05). Auch bei der medikamentösen, insbesondere oralen antimuskarinergenen Therapie sind die Non-Adhärenzraten hoch und gehen mit dem Auftreten von Nebenwirkungen und unzureichender Wirksamkeit einher [8,9]. Alternative Darreichungsformen wie die intravesikale Instillation mit Oxybutynin stellen eine adäquate Therapieoption für die Patient:innen dar und können so zum Behandlungserfolg beitragen.
Sieben neue Erklärvideos für das ärztliche Aufklärungsgespräch
Dies verdeutlicht, wie entscheidend umfassende Informationen für Betroffene sind, und betont die Notwendigkeit, Aufklärung effizienter, verständlicher und nachhaltiger zu gestalten – um durch gelungene Kommunikation die Therapieadhärenz zu sichern.
Die Firma MEDICE - The Health Family stellt als praxisnahe Unterstützung eine neue Videoserie zur Verfügung, die Ärzt:innen bei der Aufklärung von Patient:innen mit neurogener Dysfunktion des unteren Harntraktes und Detrusorüberaktivität unterstützt und dadurch das Verständnis und die Therapietreue der Betroffenen nachhaltig stärkt.
Die sieben Filme vermitteln komplexe Inhalte in kurzen Sequenzen, neutral animiert und in verständlicher Sprache – ideal für den Einsatz im Praxisalltag. Themen sind u. a. Diagnose der neurogenen Blase, Therapieoptionen und Risiken unbehandelter Blasenfunktionsstörungen, die Selbstkatheterisierung (ISK bei Mann/Frau) und intravesikale Instillation mit und Wirkweise von Oxybutynin.
Mehr Informationen zu den sieben Videos erhalten Sie unter: https://www.springermedizin.de/blasenfunktionsstoerungen-ad-medice/51090038
Alle Videos ansehen unter: https://velariq.de (für Fachkreise zugänglich über DocCheck).
Quelle: medice GmbH
Referenzen:
[1] S2k-Leitlinie Neuro-urologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten. Registernummer 179 – 001. Stand September 2021
[2] Seth JH et al. Ensuring patient adherence to clean intermittent self-catheterization. Patient Prefer Adherence 2014; 8: 191–198
[3] Wickham A et al. Clean intermittent catheterisation determinants and caregiver adherence in paediatric patients with spinal dysraphism and spinal cord injury in a paediatric spinal differences clinic: a mixed methods study protocol. BMJ Open 2024; 14: e085809
[4] Zacharia SS et al. Adherence of spinal cord injury patients in the community to selfclean intermittent catheterization (CIC) within 12 months of discharge following rehabilitation: A telephone survey.J Spinal Cord Med 2024; 31: 1-7
[5] Afsar S et al. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long-term follow-up study. Spinal Cord 2013; 51: 645-649
[6] Herbert AS et al. Internal and External Barriers to Bladder Management in Persons with Neurologic Disease Performing Intermittent Catheterization. Int J Environ Res Public Health 2023; 20: 6079
[7] Culha Y, Acaroglu R. The Effect of Video-Assisted Clean Intermittent Catheterization Training on Patients’ Practical Skills and Self-ConfidenceInt Neurourol J 2022; 26: 331- 341.
[8] Tijnagel et al. BMC Urology (2017) 17:30, DOI 10.1186/s12894-017-0216-4
[9] CME-Kurs Diagnose und Therapie neurogener Blasenfunktionsstörungen, VNR-Nummer 2760709125030960013; Lit cited herein [3, 25, 26]
Die neue siebenteilige Videoserie unterstützt Ärzt:innen bei der Aufklärung von Patient:innen mit neurogener Blasenfunktionsstörung. Ziel ist es, den Ärzt:innen die Kommunikation zu erleichtern und so die Therapietreue und das Verständnis der Patient:innen nachhaltig zu verbessern.
Die intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) ist eine etablierte Methode zur Entleerung der Harnblase bei Detrusorhyperaktivität infolge einer neurologischen Funktionsstörung [1, 2]. Sie wird in der Regel therapeutisch mit der medikamentösen Gabe eines Anticholinergikums kombiniert, das die parasympathisch vermittelten Kontraktionen des Detrusors reduziert.
Adhärenz bleibt zentrale Herausforderung
Die ISK bietet viele Vorteile, allen voran die wirksame Vermeidung von Harnwegsinfektionen, Erhalt der Nierenfunktion sowie Verbesserung der Lebensqualität durch mehr Selbständigkeit [2]. Dennoch zeigen die Daten, dass die Adhärenz im Langzeitverlauf häufig abnimmt [2] und die Non-Adärenzraten allgemein zwischen 18% und 66% liegen [3]. Laut den Ergebnissen einer prospektiven Studie befolgten nur 15% der Teilnehmenden mit einer Querschnittslähmung und neurogenen Blase vollständig den Katheterplan, 59% waren teilweise adhärent und 26 % brachen die ISK-Anwendung ab [4]. In einer Langzeitstudie lag die Rate der ISK-Anwendung bei einem ähnlichen Patient:innenkollektiv bei Entlassung aus der Rehabilitation bei 63,4 % und war bei der telefonischen Follow up-Befragung nach im Mittel 54 Monaten auf 37,5% gesunken [5].
Unzureichende Anleitung mit ein Hauptgrund für Non-Adhärenz
Die Gründe für die Non-Adhärenz sind vielfältig und beruhen auf internen, patient:innen-bezogenen Barrieren wie eine eingeschränkte Handfunktion, der für die Katheterisierung erforderliche Zeitaufwand sowie eine begrenzte Unterstützung durch Pflegepersonen und/oder auf externen Barrieren [2, 6]. Dazu gehören neben dem Fehlen barrierefreier Toiletten im öffentlichen Raum vor allem ein unzureichendes Training. Wie wichtig dies ist, zeigen auch die Daten einer Studie, bei der ein Video-unterstütztes ISK-Training signifikant die praktischen Fertigkeiten („ISK Skill“-Checkliste) sowie das Selbstvertrauen der Patient: innen im Vergleich zur Standard-Schulung (p <0,001) verbesserte [7]. Zusätzlich entwickelten trainierte Patient:innen weniger Komplikationen wie Harnwegsinfektionen, Inkontinenz, Hämaturie oder Harnröhrenstrikturen (p <0,05). Auch bei der medikamentösen, insbesondere oralen antimuskarinergenen Therapie sind die Non-Adhärenzraten hoch und gehen mit dem Auftreten von Nebenwirkungen und unzureichender Wirksamkeit einher [8,9]. Alternative Darreichungsformen wie die intravesikale Instillation mit Oxybutynin stellen eine adäquate Therapieoption für die Patient:innen dar und können so zum Behandlungserfolg beitragen.
Sieben neue Erklärvideos für das ärztliche Aufklärungsgespräch
Dies verdeutlicht, wie entscheidend umfassende Informationen für Betroffene sind, und betont die Notwendigkeit, Aufklärung effizienter, verständlicher und nachhaltiger zu gestalten – um durch gelungene Kommunikation die Therapieadhärenz zu sichern.
Die Firma MEDICE - The Health Family stellt als praxisnahe Unterstützung eine neue Videoserie zur Verfügung, die Ärzt:innen bei der Aufklärung von Patient:innen mit neurogener Dysfunktion des unteren Harntraktes und Detrusorüberaktivität unterstützt und dadurch das Verständnis und die Therapietreue der Betroffenen nachhaltig stärkt.
Die sieben Filme vermitteln komplexe Inhalte in kurzen Sequenzen, neutral animiert und in verständlicher Sprache – ideal für den Einsatz im Praxisalltag. Themen sind u. a. Diagnose der neurogenen Blase, Therapieoptionen und Risiken unbehandelter Blasenfunktionsstörungen, die Selbstkatheterisierung (ISK bei Mann/Frau) und intravesikale Instillation mit und Wirkweise von Oxybutynin.
Mehr Informationen zu den sieben Videos erhalten Sie unter: https://www.springermedizin.de/blasenfunktionsstoerungen-ad-medice/51090038
Alle Videos ansehen unter: https://velariq.de (für Fachkreise zugänglich über DocCheck).
Quelle: medice GmbH
Referenzen:
[1] S2k-Leitlinie Neuro-urologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten. Registernummer 179 – 001. Stand September 2021
[2] Seth JH et al. Ensuring patient adherence to clean intermittent self-catheterization. Patient Prefer Adherence 2014; 8: 191–198
[3] Wickham A et al. Clean intermittent catheterisation determinants and caregiver adherence in paediatric patients with spinal dysraphism and spinal cord injury in a paediatric spinal differences clinic: a mixed methods study protocol. BMJ Open 2024; 14: e085809
[4] Zacharia SS et al. Adherence of spinal cord injury patients in the community to selfclean intermittent catheterization (CIC) within 12 months of discharge following rehabilitation: A telephone survey.J Spinal Cord Med 2024; 31: 1-7
[5] Afsar S et al. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long-term follow-up study. Spinal Cord 2013; 51: 645-649
[6] Herbert AS et al. Internal and External Barriers to Bladder Management in Persons with Neurologic Disease Performing Intermittent Catheterization. Int J Environ Res Public Health 2023; 20: 6079
[7] Culha Y, Acaroglu R. The Effect of Video-Assisted Clean Intermittent Catheterization Training on Patients’ Practical Skills and Self-ConfidenceInt Neurourol J 2022; 26: 331- 341.
[8] Tijnagel et al. BMC Urology (2017) 17:30, DOI 10.1186/s12894-017-0216-4
[9] CME-Kurs Diagnose und Therapie neurogener Blasenfunktionsstörungen, VNR-Nummer 2760709125030960013; Lit cited herein [3, 25, 26]
| September 2025 |
© 2003-2026 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz