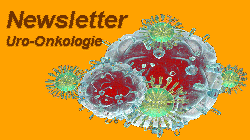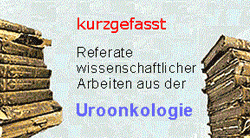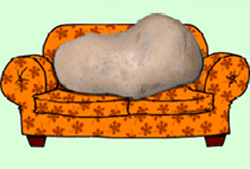Diagnose „metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC)“ – ein langer und emotional belastender Weg für Betroffene und Angehörige
Mit rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist das Prostatakarzinom in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Männern [1]. In fortgeschrittenen Stadien stehen die Patienten und ihre Angehörigen auf einem langen und insbesondere emotional belastenden Weg immer wieder vor komplexen Entscheidungen. Ist eine Heilung nicht mehr möglich, kann die enge Zusammenarbeit zwischen Urolog*innen und Nuklearmediziner*innen besonders im Hinblick auf palliative Therapieoptionen neue Perspektiven eröffnen. Im Rahmen eines Pressegesprächs beleuchteten PD Dr. med. Sebastian Frees, Facharzt für Urologie, FEBU, Mainz, PD Dr. med. Friederike Eilsberger, Fachärztin für Nuklearmedizin, FEBNM, Marburg, und Ernst-Günther Carl, Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) e.V., Bonn, welche Stationen der Patient auf seinem Weg durchlaufen kann und inwieweit eine koordinierte interdisziplinäre Versorgung ihn dabei unterstützen kann.
Der Weg eines Patienten mit Prostatakrebs nimmt häufig in der hausärztlichen oder urologischen Praxis seinen Anfang, wenn das Karzinom im Rahmen der Vorsorge mit einem erhöhten PSA (Prostata-spezifisches Antigen)-Wert auffällt, oder anhand der zu Beginn oft unspezifischen Symptome diagnostiziert wird, z.B. Schmerzen aufgrund von Metastasen. Ist das Karzinom auf die Prostata begrenzt, bieten Prostatektomie, Strahlentherapie oder Brachytherapie dem Patienten eine Chance auf Heilung [2]. Bei langsam wachsenden Karzinomen sind unter Umständen Optionen wie eine regelmäßige Überwachung ausreichend.
Liegen bereits Metastasen vor, kann dem Patienten keine Heilung mehr in Aussicht gestellt werden. Im Rahmen von Tumorkonferenzen („Tumor Boards“) besprechen dann zumeist Uroonkolog*innen, Onkolog*innen, Nuklearmediziner*innen und Radiolog*innen als Wegbegleiter*innen des Patienten disziplinübergreifend in der Klinik die Therapieoptionen. „Betroffene Männer berichten häufig über mangelnde Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen, lange Wartezeiten auf Termine und Befunde sowie die damit einhergehende, starke psychische Belastung. Es gebe immer wieder Situationen, in denen sie den Eindruck hätten, niemand habe mehr das große Ganze im Blick“, gab Carl zu bedenken. Carl hat selbst 2008 die Diagnose Prostatakrebs erhalten, welche erfolgreich mittels radikaler Prostatektomie behandelt werden konnte. Seitdem engagiert er sich als stellvertretender Vorsitzender der Selbsthilfegruppe BPS e.V. für Vorsorge, Aufklärung und Versorgung von Prostatakrebspatienten.
Interdisziplinäre Fallbesprechungen von zentraler Bedeutung [3]
„Für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom sind die interdisziplinären Fallbesprechungen von zentraler Bedeutung. Bei der Begleitung der Patienten und besonders bei der Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen und auch mit dem Patienten ist allerdings noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Dieses sollte ausgeschöpft werden, um Patienten optimal versorgen zu können“, bestätigte Frees den Eindruck von Carl. Patienten mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) in gutem Allgemeinzustand sollte zunächst ein Androgenrezeptor Pathway Inhibitor (ARPI) und eine taxanbasierte Chemotherapie angeboten werden [2]. Für Patienten können in dieser Phase der Krankheit, neben den vielen anderen Befürchtungen und Ängsten, besonders die Kontrolluntersuchungen von der Sorge vor einem Anstieg des PSA-Wertes, als Zeichen erneuter Krankheitsaktivität, begleitet sein. „Tritt ein solches biochemisches Rezidiv ein, ist es wichtig, den Patienten aufzufangen und mit ihm die weiteren Therapieoptionen zu besprechen“, so Frees. Eine mögliche Option ist dann eine erneute taxanbasierte Chemotherapie [2]. Eine weitere Therapiemöglichkeit für progrediente PSMA-positive Patienten mit mCRPC nach ARPI und taxanbasierter Chemotherapie ist die Radioligandentherapie (RLT) mit (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan (Pluvicto®) [4]. Diese wird in Kombination mit ADT angewendet und kann bei geeigneten Patienten nach der ersten taxanbasierten Chemotherapie zum Einsatz kommen [4]. Deshalb werden zunehmend auch Nuklearmediziner*innen zu Begleiter*innen des Patienten auf seinem Weg, weil sie als Behandler*innen im fortgeschrittenen Stadium die Therapie verabreichen.
Zusammenarbeit zwischen Nuklearmediziner*innen und Urolog*innen kann neue Perspektiven eröffnen
„Die enge Zusammenarbeit zwischen Urolog*innen und Nuklearmediziner*innen ist essentiell für eine gute Patientenversorgung und kann – besonders im fortgeschrittenen Krankheitsstadium – neue Therapieoptionen und Perspektiven eröffnen.“, betonte Eilsberger.
Gemeinsam sprachen sich Carl, Frees und Eilsberger bei der Versorgung von Patienten mit Prostatakarzinom für mehr gelebte Interdisziplinarität in der Praxis aus. Ihr Appell an die Fachkreise: „Wenn Urologie und Nuklearmedizin zusammenarbeiten, profitieren die Patienten – diese erfolgreiche Partnerschaft sollte weiter wachsen.“ Sie verwiesen auch auf den Bedarf an struktureller Förderung, etwa durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), zur Verbesserung der Therapiebedingungen, z.B. Verkürzung von Wartezeiten für Diagnostik und Therapie sowie eine flächendeckende Verfügbarkeit der Diagnostik als Voraussetzung zur Durchführung der PSMA-RLT.
Phänotypische Präzisionsmedizin bei fortgeschrittenem Prostatakrebs
Trotz der Fortschritte in der Prostatakrebsbehandlung besteht ein hoher ungedeckter Bedarf an zielgerichteten Behandlungsoptionen, um die Ergebnisse für Patienten mit mCRPC zu verbessern. Mehr als 80% der Patienten mit Prostatakrebs exprimieren in hohem Maße PSMA [5-8], einen phänotypischen Biomarker [6], was ihn zu einem diagnostischen (durch Positronen-Emissions-Tomographie (PET)) und therapeutischen Ziel [9] macht. Dies unterscheidet sie von der "genotypischen" Präzisionsmedizin, die auf spezifische genetische Veränderungen in Krebszellen abzielt [10].
Über (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan (Pluvicto®)
Mit der Zulassung von (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan durch die Europäische Kommission im Dezember 2022 steht die erste zugelassene Radioligandentherapie zur Behandlung von Patienten mit mCRPC zur Verfügung. Sie wird in Kombination mit Androgendeprivationstherapie (ADT) mit oder ohne Inhibition des Androgenrezeptor-(AR-) Signalwegs angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit progredientem PSMA-positiven, metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC), die zuvor mittels Inhibition des AR-Signalwegs und taxanbasierter Chemotherapie behandelt wurden [4]. Bei der Radioligandentherapie handelt es sich um eine Präzisionskrebsbehandlung, bei der ein zielgerichtetes Biomolekül (PSMA-Ligand) mit einem Radionuklid (Lutetium-177) kombiniert wird.7 Nach der Verabreichung in die Blutbahn bindet der Ligand an die PSMA-positiven Zielzellen und die von Lutetium-177 ausgehende Strahlung beeinträchtigt deren Fähigkeit, sich zu replizieren und kann zum Zelltod führen [4,12].
Quelle: Novartis Pharma GmbH
Referenzen:
[1] https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/kid_2021/kid_2021_c61_prostata.pdf?__blob=publicationFile. Letzter Zugriff am 15.05.2025.
[2] S3-Leitlinie Prostatakarzinom Version 7.0 – Mai 2024, AWMF-Registernummer: 043-022OL.
[3] https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/tipps-wie-eine-konstruktive-tumorkonferenz-gelingt. Letzter Zugriff am 15.05.2025.
[4] Fachinformation Pluvicto®, aktueller Stand.
[5] Hupe MC et al., Front Oncol 2018; 8: 623.
[6] Hope TA et al., J Nucl Med 2017; 58: 1956–1961.
[7] Minner S et al., Prostate 2011; 71: 281–288.
[8] Bostwick DG et al., Cancer 1998;82(11):2256–61.
[9] Hofman MS et al., Lancet 2020; 395: 1208–1216.
[10] Pomykala KL et al., J Nucl Med 2020; 61: 405–411.
[11] Sartor O et al., N Engl J Med 2021; 385: 1091–1103.
[12] Fendler WP, et al., J Nucl Med. 2017 Nov;58(11):1786–1792.
Mit rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist das Prostatakarzinom in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Männern [1]. In fortgeschrittenen Stadien stehen die Patienten und ihre Angehörigen auf einem langen und insbesondere emotional belastenden Weg immer wieder vor komplexen Entscheidungen. Ist eine Heilung nicht mehr möglich, kann die enge Zusammenarbeit zwischen Urolog*innen und Nuklearmediziner*innen besonders im Hinblick auf palliative Therapieoptionen neue Perspektiven eröffnen. Im Rahmen eines Pressegesprächs beleuchteten PD Dr. med. Sebastian Frees, Facharzt für Urologie, FEBU, Mainz, PD Dr. med. Friederike Eilsberger, Fachärztin für Nuklearmedizin, FEBNM, Marburg, und Ernst-Günther Carl, Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) e.V., Bonn, welche Stationen der Patient auf seinem Weg durchlaufen kann und inwieweit eine koordinierte interdisziplinäre Versorgung ihn dabei unterstützen kann.
Der Weg eines Patienten mit Prostatakrebs nimmt häufig in der hausärztlichen oder urologischen Praxis seinen Anfang, wenn das Karzinom im Rahmen der Vorsorge mit einem erhöhten PSA (Prostata-spezifisches Antigen)-Wert auffällt, oder anhand der zu Beginn oft unspezifischen Symptome diagnostiziert wird, z.B. Schmerzen aufgrund von Metastasen. Ist das Karzinom auf die Prostata begrenzt, bieten Prostatektomie, Strahlentherapie oder Brachytherapie dem Patienten eine Chance auf Heilung [2]. Bei langsam wachsenden Karzinomen sind unter Umständen Optionen wie eine regelmäßige Überwachung ausreichend.
Liegen bereits Metastasen vor, kann dem Patienten keine Heilung mehr in Aussicht gestellt werden. Im Rahmen von Tumorkonferenzen („Tumor Boards“) besprechen dann zumeist Uroonkolog*innen, Onkolog*innen, Nuklearmediziner*innen und Radiolog*innen als Wegbegleiter*innen des Patienten disziplinübergreifend in der Klinik die Therapieoptionen. „Betroffene Männer berichten häufig über mangelnde Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen, lange Wartezeiten auf Termine und Befunde sowie die damit einhergehende, starke psychische Belastung. Es gebe immer wieder Situationen, in denen sie den Eindruck hätten, niemand habe mehr das große Ganze im Blick“, gab Carl zu bedenken. Carl hat selbst 2008 die Diagnose Prostatakrebs erhalten, welche erfolgreich mittels radikaler Prostatektomie behandelt werden konnte. Seitdem engagiert er sich als stellvertretender Vorsitzender der Selbsthilfegruppe BPS e.V. für Vorsorge, Aufklärung und Versorgung von Prostatakrebspatienten.
Interdisziplinäre Fallbesprechungen von zentraler Bedeutung [3]
„Für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom sind die interdisziplinären Fallbesprechungen von zentraler Bedeutung. Bei der Begleitung der Patienten und besonders bei der Kommunikation zwischen den Fachdisziplinen und auch mit dem Patienten ist allerdings noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Dieses sollte ausgeschöpft werden, um Patienten optimal versorgen zu können“, bestätigte Frees den Eindruck von Carl. Patienten mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) in gutem Allgemeinzustand sollte zunächst ein Androgenrezeptor Pathway Inhibitor (ARPI) und eine taxanbasierte Chemotherapie angeboten werden [2]. Für Patienten können in dieser Phase der Krankheit, neben den vielen anderen Befürchtungen und Ängsten, besonders die Kontrolluntersuchungen von der Sorge vor einem Anstieg des PSA-Wertes, als Zeichen erneuter Krankheitsaktivität, begleitet sein. „Tritt ein solches biochemisches Rezidiv ein, ist es wichtig, den Patienten aufzufangen und mit ihm die weiteren Therapieoptionen zu besprechen“, so Frees. Eine mögliche Option ist dann eine erneute taxanbasierte Chemotherapie [2]. Eine weitere Therapiemöglichkeit für progrediente PSMA-positive Patienten mit mCRPC nach ARPI und taxanbasierter Chemotherapie ist die Radioligandentherapie (RLT) mit (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan (Pluvicto®) [4]. Diese wird in Kombination mit ADT angewendet und kann bei geeigneten Patienten nach der ersten taxanbasierten Chemotherapie zum Einsatz kommen [4]. Deshalb werden zunehmend auch Nuklearmediziner*innen zu Begleiter*innen des Patienten auf seinem Weg, weil sie als Behandler*innen im fortgeschrittenen Stadium die Therapie verabreichen.
Zusammenarbeit zwischen Nuklearmediziner*innen und Urolog*innen kann neue Perspektiven eröffnen
„Die enge Zusammenarbeit zwischen Urolog*innen und Nuklearmediziner*innen ist essentiell für eine gute Patientenversorgung und kann – besonders im fortgeschrittenen Krankheitsstadium – neue Therapieoptionen und Perspektiven eröffnen.“, betonte Eilsberger.
Gemeinsam sprachen sich Carl, Frees und Eilsberger bei der Versorgung von Patienten mit Prostatakarzinom für mehr gelebte Interdisziplinarität in der Praxis aus. Ihr Appell an die Fachkreise: „Wenn Urologie und Nuklearmedizin zusammenarbeiten, profitieren die Patienten – diese erfolgreiche Partnerschaft sollte weiter wachsen.“ Sie verwiesen auch auf den Bedarf an struktureller Förderung, etwa durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), zur Verbesserung der Therapiebedingungen, z.B. Verkürzung von Wartezeiten für Diagnostik und Therapie sowie eine flächendeckende Verfügbarkeit der Diagnostik als Voraussetzung zur Durchführung der PSMA-RLT.
Phänotypische Präzisionsmedizin bei fortgeschrittenem Prostatakrebs
Trotz der Fortschritte in der Prostatakrebsbehandlung besteht ein hoher ungedeckter Bedarf an zielgerichteten Behandlungsoptionen, um die Ergebnisse für Patienten mit mCRPC zu verbessern. Mehr als 80% der Patienten mit Prostatakrebs exprimieren in hohem Maße PSMA [5-8], einen phänotypischen Biomarker [6], was ihn zu einem diagnostischen (durch Positronen-Emissions-Tomographie (PET)) und therapeutischen Ziel [9] macht. Dies unterscheidet sie von der "genotypischen" Präzisionsmedizin, die auf spezifische genetische Veränderungen in Krebszellen abzielt [10].
Über (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan (Pluvicto®)
Mit der Zulassung von (177Lu)Lutetiumvipivotidtetraxetan durch die Europäische Kommission im Dezember 2022 steht die erste zugelassene Radioligandentherapie zur Behandlung von Patienten mit mCRPC zur Verfügung. Sie wird in Kombination mit Androgendeprivationstherapie (ADT) mit oder ohne Inhibition des Androgenrezeptor-(AR-) Signalwegs angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit progredientem PSMA-positiven, metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC), die zuvor mittels Inhibition des AR-Signalwegs und taxanbasierter Chemotherapie behandelt wurden [4]. Bei der Radioligandentherapie handelt es sich um eine Präzisionskrebsbehandlung, bei der ein zielgerichtetes Biomolekül (PSMA-Ligand) mit einem Radionuklid (Lutetium-177) kombiniert wird.7 Nach der Verabreichung in die Blutbahn bindet der Ligand an die PSMA-positiven Zielzellen und die von Lutetium-177 ausgehende Strahlung beeinträchtigt deren Fähigkeit, sich zu replizieren und kann zum Zelltod führen [4,12].
Quelle: Novartis Pharma GmbH
Referenzen:
[1] https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/kid_2021/kid_2021_c61_prostata.pdf?__blob=publicationFile. Letzter Zugriff am 15.05.2025.
[2] S3-Leitlinie Prostatakarzinom Version 7.0 – Mai 2024, AWMF-Registernummer: 043-022OL.
[3] https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/tipps-wie-eine-konstruktive-tumorkonferenz-gelingt. Letzter Zugriff am 15.05.2025.
[4] Fachinformation Pluvicto®, aktueller Stand.
[5] Hupe MC et al., Front Oncol 2018; 8: 623.
[6] Hope TA et al., J Nucl Med 2017; 58: 1956–1961.
[7] Minner S et al., Prostate 2011; 71: 281–288.
[8] Bostwick DG et al., Cancer 1998;82(11):2256–61.
[9] Hofman MS et al., Lancet 2020; 395: 1208–1216.
[10] Pomykala KL et al., J Nucl Med 2020; 61: 405–411.
[11] Sartor O et al., N Engl J Med 2021; 385: 1091–1103.
[12] Fendler WP, et al., J Nucl Med. 2017 Nov;58(11):1786–1792.
| Juni 2025 |
© 2003-2026 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz