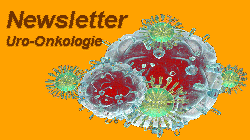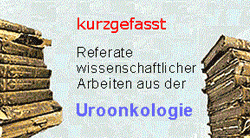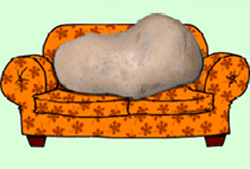INKA-App: Neueste Studienergebnisse und Erfahrungsbericht einer Nutzerin
Vom 22. bis 23.11.2024 fand der 35. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft (DKG) in Essen statt. Auf dem Symposium „Die 4. Säule der OAB-Therapie“ stellten Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Witten und PD Dr. Johannes Salem, Köln, die neuesten Ergebnisse der INKA-1-Studie vor. Diese Studie untersuchte den medizinischen Nutzen des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der Blasenhyperaktivität. Auch eine Patientin berichtete auf dem Symposium über ihre Erfahrungen im Alltag mit der INKA-App.
Von dem Syndrom der überaktiven Blase (overactive bladder, OAB) sind ca. 11-16 % aller erwachsenen Menschen betroffen [1]. Der Anteil der betroffenen weiblichen Bevölkerung liegt bei 8-42% und der männlichen Bevölkerung bei 10-26% [2]. Die OAB kann sich mit oder ohne Inkontinenz zeigen. Inkontinenz im Allgemeinen betrifft einen großen Teil der Bevölkerung. Im Telefonischen Gesundheitssurvey 2005 des Robert Koch-Institutes gab ein Viertel der befragten Frauen im Alter von 60 bis 69 Jahren und 10 % der Männer dieser Altersgruppe an, von Inkontinenz betroffen zu sein [3]. Die Harninkontinenz ist ein belastendes Symptom und kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen und körperliche, psychische, soziale sowie finanzielle Folgen haben [4].
Therapie der überaktiven Blase – Verhaltenstherapien als Erstlinienbehandlung
Verhaltenstherapien sind nach der Leitlinie die erste Wahl bei der Behandlung einer OAB. Sie beinhalten u.a. die Anpassung des
Trinkverhaltens, Meidung von harntreibenden Mitteln wie Koffein, Blasentraining (Ziel ist die Miktionskontrolle) und eine Stärkung des
Beckenbodens [4]. Die Nachhaltigkeit von Beckenbodentrainings ist jedoch aufgrund einer häufig schlechten Adhärenz eingeschränkt
und auch der Nutzen des Blasentrainings ist nur von kurzer Dauer, wenn das Training nicht wiederholt wird [4]. Wenn die
Verhaltenstherapien keine zufriedenstellende Wirkung haben, stehen nachfolgend medikamentöse Interventionen (Anticholinergika,
Beta-3-Adrenozeptor-Agonisten) zur Verfügung. Die Therapie mit Anticholinergika ist oft von hohen Abbruchraten geprägt, hauptsächlich
zurückzuführen auf unzureichende Wirksamkeit und/oder Nebenwirkungen [4]. Bei unzureichendem Erfolg der medikamentösen Therapie
sind invasive Maßnahmen (Injektion von Onabotulinumtoxin A in die Harnblasenwand, elektrische Neuromodulation und operative Verfahren) angezeigt [4].
Verhaltensänderung als vielversprechender Therapieansatz: Die INKA-App als digitaler Therapiebegleiter – genau dann, wann sie benötigt wird
„OAB-Therapie anders gedacht“
Prof. Dr. Wiedemann erläuterte in seinem Vortrag „OAB-Therapie anders gedacht“, dass Symptome des unteren Harntraktes (LUTS)
erlernt werden können: Lernen, im Sinne des Behaviorismus, erfolgt durch klassische Konditionierung, bei der Umweltreize mit
Verhaltensreaktionen verknüpft werden. Auf die Miktionskontrolle übertragen, kann Harndrang mit neutralen Reizen wie der Haustür
assoziiert werden, was durch Wiederholungen zu spezifischen Reaktionen führt, etwa plötzlichem Harndrang beim Heimkommen.
„Wenn LUTS erlernt werden können, könnte hier therapeutisch eingegriffen werden.“ schlägt Prof. Dr. Wiedemann vor. Daher legt er
nahe, das zentrale Nervensystem als Ansatzpunkt zu nutzen, alte Verhaltensweisen durch die Schaffung neuer Reize und dem
Erlernen neuer Verhaltensmuster zu „löschen“. Für eine nachhaltige Verhaltensänderung ist es entscheidend, neue Verhaltensweisen
zu wiederholen und mit positiven Reaktionen zu verstärken. Die INKA-App als digitaler Therapiebegleiter für Patient:innen mit OAB
oder Belastungsinkontinenz wurde mit genau dieser Intention entwickelt. Der Alltag mit der INKA-App ist darauf ausgelegt, die
Symptome von Menschen mit OAB mit oder ohne Harninkontinenz zu lindern, Verhaltensmuster zu erkennen und durch strukturierte
Übungen und Erinnerungen bei Verhaltensanpassungen zu unterstützen. Patient:innen können durch die Visualisierung von
Fortschritten die Verhaltensänderung verfolgen und so motiviert werden, neu erlernte Verhaltensweisen zu wiederholen. Besonders
die Erinnerungen könnten die Adhärenz zu z.B. Beckenboden- und Blasentrainings verbessern und so einen Therapieerfolg unterstützen.
Die App kann in verschiedenen Alltagssituationen genutzt werden und passt sich an die Bedürfnisse der Nutzer:innen an.
Die INKA-App ist unabhängig von Behandlungsort und Sprechzeiten überall einsetzbar – genau dann, wenn sie benötigt wird.
Sie bietet Patient:innen personalisierte Trinkempfehlungen, Blasentraining mit Ablenkungsübungen, systematisches Beckenbodentraining,
Erinnerungen an Medikamenteneinnahme und Lerninhalte (Erkrankung, Verhalten). Darüber hinaus ist für Ärzt:innen die multiple
Datenerfassung und ein digitaler Arztbericht von Vorteil: Durch die automatisierte Erfassung inklusive Miktionsprotokoll,
ICI-Q (The International Consultation on Incontinence Questionnaire) mit LQ (Lebensqualität)-Fragebogen, CCS (Cleveland Clinic
Incontinence Score) und PAD-Test ist eine gute Verlaufskontrolle ohne Personal-Einsatz in den Praxen möglich.
Der Nutzen der INKA-App wurde in einer Studie untersucht.
INKA-App: Neueste Studienergebnisse
PD Dr. Johannes Salem stellte im Rahmen des Symposiums die neusten Ergebnisse der INKA-1-Studie vor. Die Studie dient
der Bewertung des medizinischen Nutzens des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der OAB. Die INKA-1-Studie
ist eine offene, randomisierte, kontrollierte, zweiarmige, multizentrische Studie über 12 Wochen. Ca. 250 erwachsene Patient:innen
bei stabiler pharmakologischer Behandlung (≥4 Wochen) sind Teil der Studie [5,6,7]. Der primäre Endpunkt ist die Reduktion der
Anzahl der Miktionen pro Tag. Die ersten Ergebnisse zeigen, durch die Benutzung des digitalen Therapiebegleiters INKA kann
bei therapierefraktären Patient:innen die Anzahl täglicher Miktionen pro Tag (ø 3 Tage Blasenprotokoll um ≥15%) in klinisch
relevantem Ausmaß reduziert werden [5,6,8]. Bei Frauen ist dieser Effekt statistisch signifikant [6].
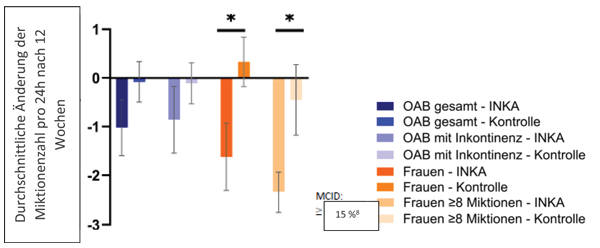
Abb.: Die Daten stellen die durchschnittlichen Veränderungen der Anzahl der Miktionen pro 24 Stunden gegenüber dem
Ausgangswert nach 12 Wochen dar [6]
± Standardfehler des Mittelwerts (SEM); zweiseitiger gepaarter t-Test; MCID = Minimal Clinically Important Difference *p<0,05,
„OAB gesamt“ n=85, „OAB mit Inkontinenz“ n=73, Frauen n=63, Frauen=8 Miktionen bei Baseline n=39
[8]).
Es konnte zudem die Symptomlast in klinisch relevantem Ausmaß gesenkt und die Lebensqualität von Patient:innen mit OAB, ebenfalls
in einem klinisch relevanten Umfang, verbessert werden [6]. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des DiGA (Digitale Gesundheits-Anwendung)-
Kandidaten INKA, klinische Symptome von OAB zu lindern. Laut PD Dr. Johannes Salem soll in der INKA-2-Studie (konfirmatorische klinische Studie)
der Nachweis der Wirkung des digitalen Therapiebegleiters INKA auf die Symptome der OAB (mit oder ohne Harninkontinenz) bestätigt werden.
Erfahrungsbericht einer Patientin mit der INKA-App im Alltag Im Zuge des Symposiums Die vierte Säule der OAB-Therapie auf dem DKG
erzählte eine Betroffene mit OAB in einem lebhaften Gespräch mit Prof. Dr. Wiedemann über ihre Erfahrungen im Alltag mit der INKAApp.
Die Patientin berichtete von einem typischen Symptombild der OAB: Häufige und oftmals sehr plötzlich auftretende und dringliche Miktionen.
Besonders letzteres schilderte die Patientin als sehr belastend. „Das Schlimmste ist, dass ich den Blasendruck erst merke, wenn ich aufstehe.
Dann nimmt er wahnsinnig zu und ich kann ihn kaum aushalten.“ erzählt die Patientin. Auch ihr soziales Umfeld nahm die häufigen Miktionen
wahr: „Ich habe einen sehr vielfältigen Bekannten- und Freundeskreis und alle wissen: Die muss häufig auf die Toilette. Und alle stellen sich
darauf ein.“
Als Teilnehmerin der Studie durfte sie die INKA-App über 12 Wochen testen. Zu Beginn der Nutzung der App zeigte sich die 73-jährige
Patientin aufgeschlossen und positiv gestimmt, eine Haltung, die sie über die gesamten Studiendauer beibehielt: „Ich war positiv überrascht.
Am allerbesten hat mir das Beckenbodentraining gefallen.“, berichtete die Patientin. Obwohl sie aus früheren Sportkursen bereits viele
Beckenbodenübungen kannte, berichtete sie begeistert von neuen und abwechslungsreichen Übungen in der App, die sie gerne regelmäßig
durchgeführt hat. Die Übungen wurden speziell für die INKA-App in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Silke von der Heide, Fachärztin für
Physikalische und Rehabilitative Medizin, entwickelt und können von den Nutzer:innen mit Anleitungsvideos eingeübt werden. Die
Patientin legte auch nahe, dass die Nutzung der INKA-App Eigeninitiative voraussetzt, so wie das auch bei der Einnahme einer
Tablette erforderlich ist.
Des Weiteren berichtete die Patientin von einer guten Integration der INKA-App in den Alltag: Durch die Verhaltensbeobachtung gelang
es ihr, den Kaffeekonsum zu reduzieren und Trinkgewohnheiten zu entwickeln, die mit ihrem Alltag harmonieren. Die Beckenbodenübungen
konnte sie schon morgens noch im Liegen durchführen. Auch im Laufe des Tages ließ sich das Training problemlos in ihren Alltag integrieren –
sei es in der Bahn oder anderen Situationen, stets unkompliziert und ohne die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung zu erregen.
Eine Verbesserung der Symptome fiel nicht nur der Patientin selbst auf, sondern wurde auch von ihrem sozialen Umfeld wahrgenommen.
Die Patientin setzte das Beckenbodentraining auch nach Abschluss der 12-wöchigen Studiendauer gerne fort. Auf Nachfrage aus dem
Publikum ob sie die Übungen weiter macht, antwortet die Patientin: „Die Übungen mache ich weiter. Heute Morgen habe ich sie schon
alle gemacht, gleich mache ich sie auch, wenn ich im Zug auf der Rückfahrt sitze!“ Zum Abschluss des Symposiums stellte
Prof. Dr. Wiedemann die Frage, wie viele der Anwesenden sich vorstellen könnten, einen solchen digitalen Therapiebegleiter künftig
in die Behandlung ihrer Patienten mit OAB und Mischharninkontinenz einzubinden. Die große Mehrheit zeigte sich dafür aufgeschlossen
und stimmte zu.
Referenzen:
[1] Uniklinik RWTH Aachen. Überaktive Blase. Online verfügbar unter:
https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/klinik-fuer-urologie-und-kinderurologie/fuer-patienten/erkrankungen/blase/ueberaktive-blase/ (letzter Zugriff: 04.12.2024)
[2] Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Anlage zur Zusammenfassenden Dokumentation/Abschlussbericht. Sakrale
Neuromodulation durch ein implantierbares, wieder aufladbares Stimulationssystem bei überaktiver Blase, Harnverhalt und Stuhlinkontinenz.
Stand: 23.01.2020. Online verfügbar unter:
https://www.g-ba.de/downloads/40-268-6515/2020-04-16_137h_BAh-19-004_Sakrale-Neuromodulation_ZD-Anlage.pdf (letzter Zugriff: 04.12.2024)
[3] Robert Koch-Institut (Hrsg) (2007) Harninkontinenz. Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 39. Robert Koch-Institut, Berlin.
Online verfügbar unter:
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3191/26Herxag1MT4M_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y (letzter Zugriff: 04.12.2024)
[4] S2k-Leitlinie Harninkontinenz der Frau. AWMF-Registernummer 015-091, Stand Dezember 2021, Version 1.0. Online verfügbar unter:
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/015-091l_S2k_Harninkontinenz-derFrau_2022-03.pdf, (letzter Zugriff: 04.12.2024)
[5] Federal Institute for Drug and Medicine Devices. Online verfügbar unter:
https://drks.de/search/en/trial/DRKS00029329 (letzter Zugriff: 04.12.2024)
[6] Schramm L et al. A randomized, open-label, controlled clinical study to assess the digital health application INKA in the management
of therapy refractory overactive bladder and mixed incontinence. Posterpräsenstation, 65. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG), 16.-19. Oktober 2024 in Berlin, Deutschland.
[7] Salem J. INKA-App bei therapierefraktärer OAB – erste Studienergebnisse. Präsentation, 35. Kongress der Deutschen Kontinenz
Gesellschaft (DKG), 22.-23. November 2024 in Essen, Deutschland
[8] Frankel J et al. Adv Ther. 2022;39:959–70.
| Januar 2025 |
© 2003-2026 pro-anima medizin medien
–
impressum
–
mediadaten
–
konzeption
–
datenschutz